107 Gesetze an 68 Sitzungstagen verabschiedet
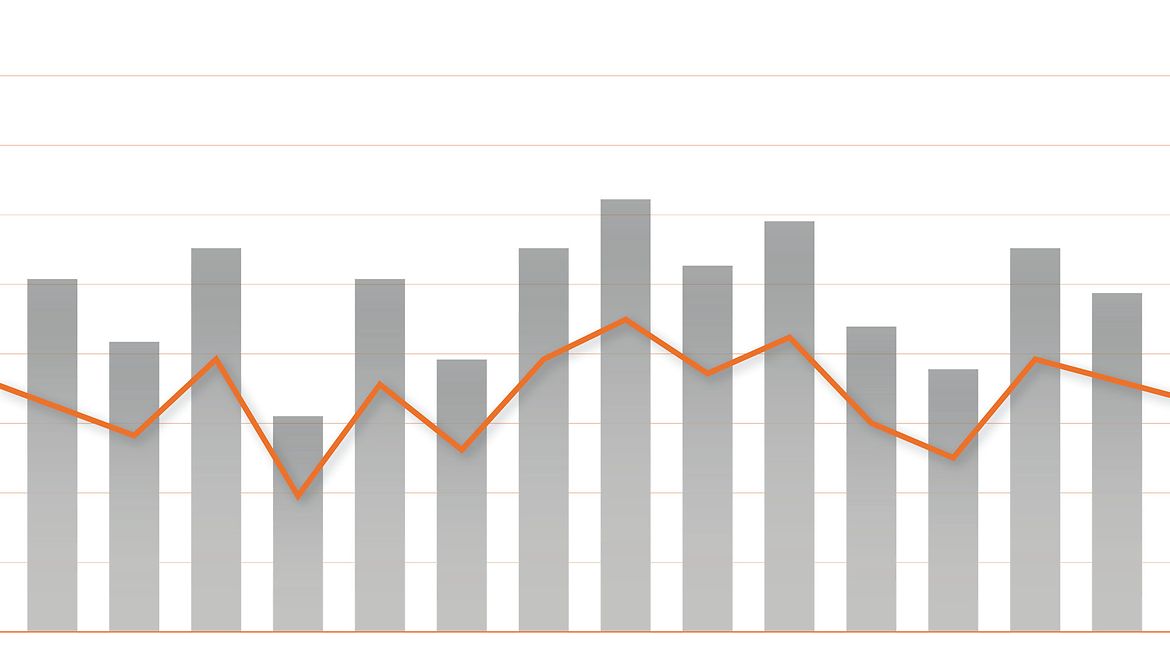
Der Bundestag hat 107 Gesetze im Jahr 2023 verabschiedet. (© DBT/Klimpel)
Insgesamt 107 Gesetze hat der Deutsche Bundestag im Jahr 2023 verabschiedet. Davon hatte die Bundesregierung 89 Gesetzentwürfe eingebracht. 14 gingen auf eine Initiative des Bundestages zurück, eine auf die des Bundesrates. Bei letzterer handelt es sich um den vom Bundesrat in seiner 1022. Sitzung am 10. Juni 2022 beschlossenen Entwurf eines Gesetzes zur Ermöglichung digitaler Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht (20/2532). Der Gesetzentwurf wurde von den Abgeordneten am 9. Februar in dritter Beratung behandelt und in der Ausschussfassung (20/5585) angenommen. Das „Gesetz zur Ermöglichung hybrider und virtueller Mitgliederversammlungen im Vereinsrecht“ ist am 21. März 2023 in Kraft getreten.
Drei weitere Gesetze ergingen auf der Grundlage von Beschlussempfehlungen. Dabei handelt es sich um das „Gesetz zur Änderung des Erneuerbare-Energien-Gesetzes zur Vermeidung kurzfristig auftretender wirtschaftlicher Härten für den Ausbau der erneuerbaren Energien“ (20/9781), das „Haushaltsfinanzierungsgesetz 2023“ (20/9666) und das „Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024“ (20/9792). Alle drei wurden am 15. Dezember vom Parlament verabschiedet und sind überwiegend bereits in Kraft getreten. Die Artikel 4 bis 6 des Haushaltsfinanzierungsgesetz 2024 treten am 1. Januar 2025 in Kraft.
Gesetzentwürfe aus dem Bundestag
12 der 14 vom Bundestag selbst eingebrachten und verabschiedeten Gesetzentwürfe stammen von der Regierungskoalition, bestehend aus SPD-Fraktion, Bündnis 90/Die Grünen und FDP.
Gemeinsam mit der Unionsfraktion eingebracht und verabschiedet wurden das Gesetz zur Finanzierung politischer Stiftungen aus dem Bundeshaushalt (Stiftungsfinanzierungsgesetz, 20/8726) – es ist am 23. Dezember 2023 in Kraft getreten – und das Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes (20/9147) – es ist am 5. März 2024 in Kraft getreten, Artikel 1 Nummer 5 des Gesetzes tritt am 1. Januar 2025 in Kraft.
183 Gesetzentwürfe beim Bundestag eingebracht
Insgesamt gingen im vergangenen Jahr 183 Gesetzentwürfe beim Bundestag ein, neben 118 Regierungsvorlagen und 57 Initiativen aus dem Parlament selbst noch acht Vorschläge des Bundesrates. Von den 57 Vorlagen aus dem Parlament stammten 16 von der Regierungskoalition, 24 von der AfD-Fraktion, 14 von der CDU/CSU-Fraktion und eine von der Linksfraktion.
SPD, CDU/CSU, Bündnis 90/Die Grünen und FDP haben zwei gemeinsame Vorschläge eingebracht. Dabei handelt es sich um die oben genannten, bereits verabschiedeten Gesetze – das Stiftungsfinanzierungsgesetz und das Gesetz zur Änderung des Parteiengesetzes. Insgesamt 169 Gesetzentwürfe haben die Abgeordneten in erster Beratung behandelt.
AfD mit den meisten Anträgen
Beim Parlament wurden 463 selbstständige Anträge eingebracht. Mit ihnen wird beispielsweise die Beratung bestimmter Ereignisse oder Politikbereiche beantragt, wie die Änderung eines Gesetzes. Auch kann die Bundesregierung aufgefordert werden, dem Parlament über bestimmte Ereignisse oder Politikbereiche zu berichten oder einen Gesetzentwurf vorzulegen. Die meisten Anträge stellte die Fraktion der AfD mit 205, gefolgt von der CDU/CSU mit 162 und der Linken mit 78.
Die Fraktionen der Regierungskoalition stellten zusammen 15 Anträge. Zweimal formulierten sie gemeinsame Forderungen mit der CDU/CSU. Dabei handelt es sich zum einen um den Antrag „Mahnmal für die im Nationalsozialismus verfolgten und ermordeten Zeugen Jehovas“ (20/6710) und zum anderen um den Antrag „Anerkennung und Gedenken an den Völkermord an den Êzîdinnen und Êzîden 2014“ (20/5228).
Außerfraktioneller Antrag zur Suizidprävention
In einem Fall legten Abgeordnete ohne Beteiligung der Fraktionen einen gemeinsamen Antrag vor. Der Antrag der Abgeordneten Dr. Kirsten Kappert-Gonther (Bündnis 90/Die Grünen), Martina Stamm-Fibich (SPD) und anderer „Suizidprävention stärken“ (20/7630) wurde am 6. Juli in namentlicher Abstimmung angenommen.
Entschließungsanträge
Die Zahl der Entschließungsanträge belief sich auf insgesamt 60. Entschließungen müssen sich auf eine vorliegende Initiative beziehen und werden zur dritten Beratung von Gesetzentwürfen oder zur Beratung von Großen Anfragen oder zu Regierungserklärungen im Plenum eingebracht.
Mit 32 Entschließungsanträgen lag die CDU/CSU vor der AFD mit 16, gefolgt von der Linksfraktion mit sieben. Gemeinsam mit der Union formulierten die Regierungsparteien SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP einen Entschließungsantrag (20/8736) zu der Regierungserklärung des Bundeskanzlers Olaf Scholz (SPD) am 12. Oktober 2023 zur Lage in Israel. Das Regierungsbündnis stellte zusammen vier Entschließungsanträge.
Aktuelle Stunden, Vereinbarte Debatten, Fragestunden, Regierungsbefragungen
Auch die Kontrolltätigkeit des Parlaments schlägt sich in Zahlen nieder. In 45 Aktuellen Stunden debattierte der Bundestag auf Verlangen der Fraktionen über aktuelle Entwicklungen. In zwölf Vereinbarten Debatten vertraten die Abgeordnete des Bundestages ihre Meinung zu einem aktuellen Thema, wie zum 75. Jahrestag der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte, zur Klimaaußenpolitik anlässlich der Klimakonferenz 2023 der Vereinten Nationen in Dubai, zum Internationalen Tag zur Beseitigung von Gewalt gegen Frauen, anlässlich des 175. Jahrestages des Einzugs der deutschen Nationalversammlung in die Frankfurter Paulskirche oder zu 60 Jahren deutsch-französischer Freundschaftsvertrag.
Solche Aussprachen im Plenum haben weder eine Vorlage noch eine Regierungserklärung als Beratungsgegenstand. In 21 Fragestunden stellten sich Regierungsvertreter den Auskunftswünschen der Abgeordneten und in ebenso vielen Regierungsbefragungen informierte die Bundesregierung über aktuelle Kabinettsbeschlüsse.
Regierungserklärungen
Neun Regierungserklärungen wurden abgegeben. Acht durch Bundeskanzler Scholz (SPD) am 13. Dezember zum Europäischen Rat am 14. und 15. Dezember 2023, am 28. November zu den Folgen des Urteils des Bundesverfassungsgerichts zum Nachtragshaushalt 2021, am 19. Oktober zum EU-Gipfel am 26. und 27. Oktober, am 12. Oktober zum Angriff der islamistischen Hamas auf Israel am 7. Oktober, am 22. Juni zum EU-Gipfel am 29. und 30. Juni in Brüssel und zum Nato-Gipfel am 11. und 12. Juli in Litauens Hauptstadt Vilnius, am 16. März zum EU-Gipfel am 23. und 24. März, am 2. März aus Anlass des russischen Angriffskrieges gegen die Ukraine und am 8. Februar zum außerordentlichen Europäischen Rat am 9. und 10. Februar zum Krieg in der Ukraine, zu Wirtschaft und Migration.
Der Bundesminister für Wirtschaft und Klimaschutz Dr. Robert Habeck (Bündnis 90/Die Grünen) hat am 26. Januar eine Regierungserklärung vor dem Bundestag abgegeben. Anlass war die erste Beratung des Jahreswirtschaftsberichts 2023 der Bundesregierung (20/5380) zusammen mit dem Jahresgutachten 2022 / 23 des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung (20/4560).
Große und Kleine Anfragen
Bei wichtigen politischen Fragen greifen die Fraktionen zum Mittel der Großen Anfrage. Die AfD-Fraktion stellte sieben, die Union vier und Die Linke eine Große Anfrage an die Bundesregierung. Die schriftlichen Antworten der Bundesregierung auf Große Anfragen werden im Plenum des Bundestages beraten, wenn mindestens fünf Prozent der Abgeordneten dies verlangen.
1.458 Mal nutzten die Fraktionen eine Kleine Anfrage, um die Bundesregierung zur Stellungnahme zu einem bestimmten Sachverhalt zu bewegen. Kleine Anfragen kamen zum großen Teil von der AfD (635) und der Linken (429), die CDU/CSU stellte 394. Kleine Anfragen müssen von der Bundesregierung in der Regel innerhalb von zwei Wochen schriftlich beantwortet werden. Sie werden nicht im Plenum beraten.
Fragen der Abgeordneten an die Regierung
Die Parlamentarier hatten 7.256 schriftliche und 1.073 mündliche Fragen an die Bundesregierung. Die meisten schriftlichen Fragen stellten Abgeordnete der CDU/CSU (3711), der AfD (1.868) und der Linken (1.231). Abgeordnete von SPD, Bündnis 90/Grüne und FDP hatten 14, 184 und 43 schriftliche Fragen an die Bundesregierung gerichtet. Einzelne Abgeordnete, die keiner Fraktion oder Gruppe angehören, stellten 205 schriftliche Fragen.
Auch die meisten mündlichen Fragen kamen von Abgeordneten der Unionsfraktion (504), der Linksfraktion (265) und der AfD-Fraktion (246). Abgeordnete von Bündnis 90/Grünen hatten 40, SPD- und FDP-Abgeordnete keine mündlichen Fragen. 18 mündliche Fragen kamen von fraktionslosen Abgeordneten.
4.839 Bundestagsdrucksachen veröffentlicht
Das Plenargeschehen aller 68 Sitzungstage kann man im Plenarprotokoll auf insgesamt 9.196 Seiten nachlesen. Als Video abrufbar sind alle Plenarsitzungen und Redebeiträge in der Mediathek des Bundestages. Alle 4.839 Plenardrucksachen des vergangenen Jahres sind unter www.bundestag.de/dokumente und im Dokumentations- und Informationssystem für Parlamentarische Vorgänge (DIP) abrufbar, alle 55 namentlichen Abstimmungen des vergangenen Jahres unter www.bundestag.de/abstimmung.
Die Drucksachen bilden alle parlamentarischen Initiativen ab, also Gesetzentwürfe und Verordnungen, Anträge, Entschließungs- und Änderungsanträge, Beschlussempfehlungen und Berichte (715), Große und Kleine Anfragen sowie Unterrichtungen. (klz/02.05.2024)